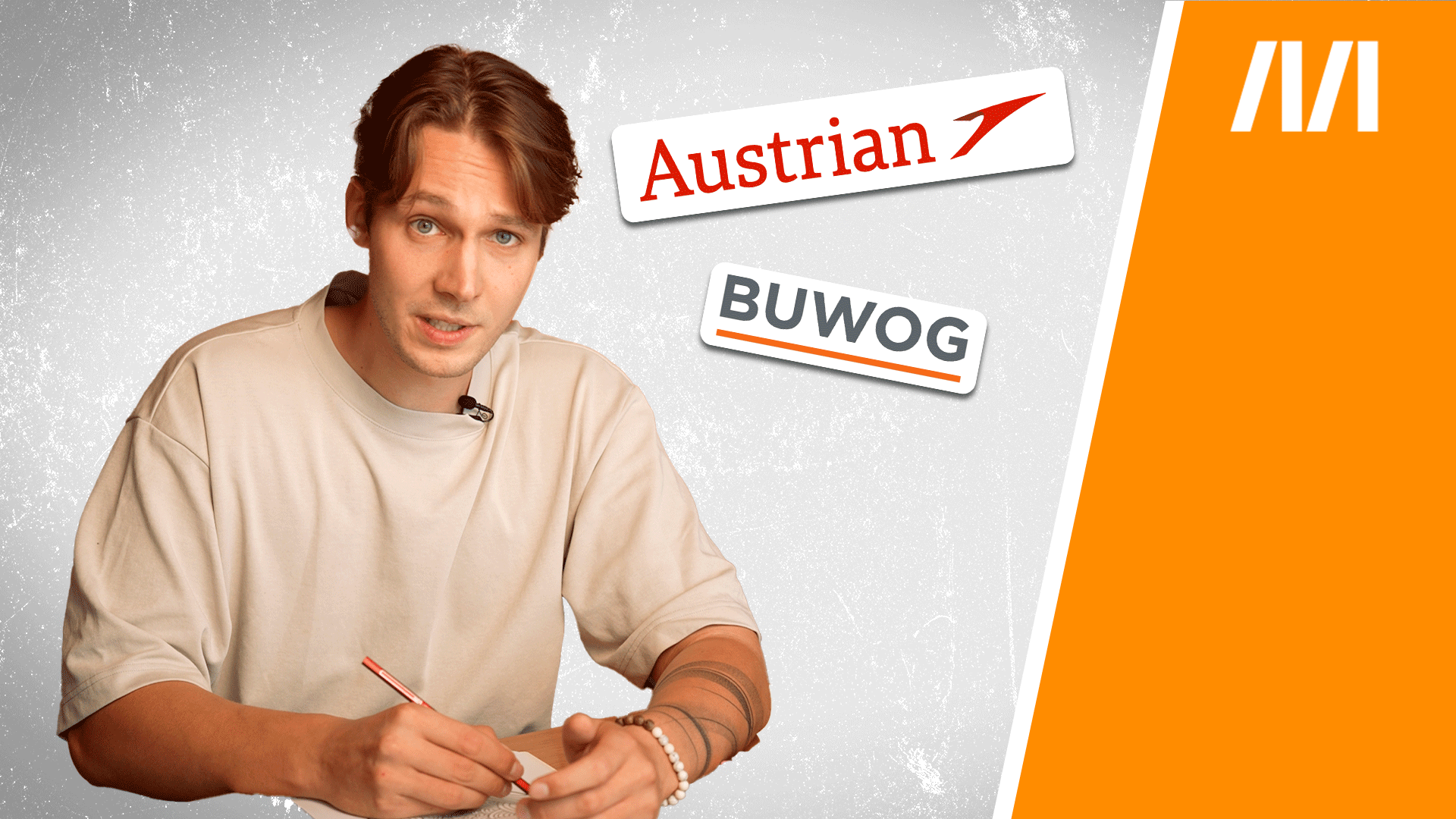Systemwechsel? Wie man die Demokratie verteidigt - und verbessert
Fast die Hälfte der Menschen in Österreich sagt inzwischen, sie wollen ein anderes politisches System. Nicht eine andere Regierung, nicht ein paar Gesichter austauschen, nein, ein anderes System. Also deutlicher kann die Botschaft nicht sein: Viele fühlen sich nicht mehr vertreten in unserer Demokratie. Das wurde eher achselzuckend zur Kenntnis genommen. Da könne man irgendwie nichts machen. Interessiert sich niemand für das Warum? Warum empfinden so viele, dass dieses System ihnen nichts mehr bringt?
Moment mal!
Um diese Fragen zu verstehen, reicht ein Blick aufs parteipolitische Tagesgeschäft nicht aus. Wir müssen zu den Bedingungen vordringen, die das Gefühl erzeugen, dass die Zeiten irgendwie eng und unsicher werden. Eng und unsicher im Geldbörsl, aber auch im Kopf.
Unsicherheit ist der Nährboden jeder Sehnsucht nach Ordnung, Klarheit, einfachen Lösungen, die autoritäre Kräfte so erfolgreich bedienen. Aber diese Unsicherheit entsteht nicht zufällig, die fällt nicht vom Himmel, sie wird politisch hergestellt. Und Unsicherheit und Knappheit macht was mit uns, denn unser Gehirn reagiert darauf.
Politik und "Scarcity Mindset"
In der Psychologie ist das gut erforscht. Es heißt scarcity mindset, ein Knappheitsmodus im Denken. Unser Gehirn reagiert damit auf dauerhaften Stress. Wenn Geld, Zeit, Wohnen oder gesundheitliche Sicherheit knapp werden, verengt sich unser Denken. Wir verlieren kognitive Bandbreite. Wir sind weniger empathisch. Wir sehen weniger Optionen. Wir bekommen einen Tunnelblick.
Ein Beispiel: Anna ist 44, arbeitet im Einzelhandel, verdient knapp über Mindestlohn. Die Preise steigen, die Miete ist erhöht worden, und ihr Sohn braucht neue Sportschuhe für die Schule. Anna jongliert jeden Monat mit Rechnungen, Mahnungen und der Frage, was sie sich noch leisten kann.
Eines Abends kommt sie müde von der Arbeit nach Hause. Im Kühlschrank hätte sie noch ein bisschen Gemüse, auch Nudeln, eine halbe Packung Tomatenmark. Ein Essen, das wenige Euro kostet, aber eine halbe Stunde Zeit braucht. Zeit, die sie nach neun Stunden Stehen im Geschäft nicht mehr aufwenden will. Am Heimweg ist sie an einem Asia-Imbiss vorbeigegangen, 15 Euro, warm, sofort fertig. Sie weiß, dass es teurer ist, sie weiß, dass es weniger gesund ist, aber sie greift trotzdem zum Take-away. Nicht weil sie “unvernünftig” ist, sondern weil ihre mentale Bandbreite erschöpft ist.
Dauerstress verändert die Perspektive
Das ist kein persönlicher Defekt von Anna. Das ist eine menschliche Reaktion. Wenn das Gehirn über Wochen oder Monate unter Druck steht, verengt sich der Fokus auf das Jetzt. Die Zukunft schrumpft weg. Entscheidungen werden kurzfristiger, impulsiver, defensiver. Nicht weil man dumm wäre, sondern weil das Gehirn auf diese Weise versucht, den Stress zu verringern. Der Autor Rutger Bregman erklärt es so: Wer arm ist, ist wie ein Computer mit zu vielen Programmen, die gleichzeitig laufen. Er reagiert weniger gut, nicht weil er kaputt ist, sondern weil er überlastet ist.
Dieses Muster wiederholt sich überall dort, wo Menschen permanent Mangel erleben. Sie treffen keine „schlechten Entscheidungen“, sie treffen die bestmögliche Entscheidung - aber halt unter Knappheitsdruck.
Die falsche Nullsummenlogik
Und nun kommt der entscheidende Schritt: Was individuell gilt, gilt auch gesellschaftlich. Wenn ganze Bevölkerungsschichten über Jahre hinweg unter Preisdruck, unsicheren Jobs, Wohnungsnot und kaputten öffentlichen Diensten leiden, entwickelt die Gesellschaft einen kollektiven Knappheitsmodus im Denken. Es verengt sich der politische Blick. Komplexe Lösungswege wirken überfordernd, einfache Botschaften plötzlich attraktiv.
Alles wird zum Kampf um zu wenige Ressourcen. Das ist die Nullsummenlogik: Wenn andere etwas bekommen, bleibt für mich weniger übrig. Wenn jemand anderes „ein größeres Stück Kuchen“ hat, dann wird mein Stück kleiner. Keiner kommt auf die Idee: Dann backen wir eben mehr Kuchen. Denn eine Politik der Austerität erzählt uns: Nein, das geht nicht. Wir müssen verzichten. Dabei stimmt das objektiv nicht. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Es gibt genug Wohlstand. Aber der ist sehr ungleich verteilt. Wir sparen bei öffentlichen Leistungen, aber nicht bei Vermögenden. Wir kürzen bei Pflege, Wohnen und Pensionen, erzählen aber gleichzeitig, man habe „über den Verhältnissen gelebt“
Trügerische Erfahrungen bestärken falsche Theorie
Der angebliche Mangel ist das Ergebnis politischer Entscheidungen. Wenn Wohnungen knapp und immer teurer werden, spüren wir: „Da nimmt mir jemand etwas weg.“ Wenn der Arzt nur mehr Termine in sechs Monaten hat, spürt man: „Wir sind zu viele.“ Und weil diese Engpässe real erlebt werden, wirken rechte Erzählungen plausibel, obwohl sie inhaltlich falsch sind. Migration sei schuld. Sozialleistungen seien schuld. „Die anderen“ seien schuld.
Nullsummenlogik braucht keine Beweise, sie braucht nur einen Mangel, den ich erlebt habe. Diese “Logik” wird jetzt in Zeiten des Sparens nochmal kräftig befeuert. “Wir haben über unseren Verhältnissen gelebt”, “Jeder muss was beitragen”, “Alle müssen den Gürtel enger schnallen” und so weiter und so weiter.
Die autoritäre Basis
Robert Misik beschreibt diese Rhetorik als “Kult der Härte”: Härte für die, die ohnehin wenig haben; Schonung für die, die viel besitzen. Es ist eine Erzählung, die Härte idealisiert und Empathie als Schwäche abwertet. Und genau diese Härte-Erzählung bringt uns politisch dorthin, wo autoritäre Kräfte seit jeher ihre Energie beziehen: aus dem Gefühl, allein gelassen zu sein.
Wenn öffentliche Dienste geschlossen werden, wenn der Bus nur noch einmal am Tag fährt, wenn die Kinderbetreuung ausgedünnt ist, wenn Schulen nicht renoviert werden und Wohnbauprogramme versanden, dann bröckelt das Vertrauen in die Demokratie. Demokratie lebt nicht nur vom Wahlrecht, sondern davon, dass Menschen spüren: Diese Gesellschaft sorgt auch für mich. Wenn der Staat aber nur noch als Bürokratie spürbar ist, nicht als Infrastruktur des Gemeinwohls, dann wird er zum Gegner. Der Journalist George Monbiot hat das treffend beschrieben: Wenn alles, was vom Staat sichtbar bleibt, Strafen, Regeln und Engpässe sind, dann ist er Belastung statt Schutz. Dann kann er weg.
Abstiegsangst als Futter der Härte
Die Soziologie zeigt seit Jahren, dass es nicht die Ärmsten sind, die autoritäre Parteien wählen, sondern jene, die noch etwas zu verlieren haben: die untere Mittelschicht. Genau jene Menschen, die – wie der Soziologe Oliver Nachtwey es beschreibt – das Gefühl haben, auf einer Rolltreppe zu stehen, die nach unten fährt. Diese Abstiegsangst ist politisch explosiv. Sie macht empfänglich für jene, die versprechen, “Ordnung” herzustellen, Grenzen zu schließen, “die da oben” zu bestrafen und “die da unten” ordentlich zu gängeln.
Und dann kommt der Punkt, an dem autoritäre Politik als logische Lösung erscheint. Wenn alles knapp ist, braucht man jemanden, der verteilt. Wenn alles bedroht wirkt, braucht man jemanden, der schützt. Wenn rationale Debatten zu anstrengend sind, wirken Feindbilder befreiend.
Auf Systemfragen braucht es die richtigen Antworten
Das ist auch der Grund, warum fast die Hälfte der Menschen in Österreich einen Systemwechsel will. Wie Natascha Strobl betont, wollen viele nicht weniger Demokratie – sondern eine andere. Eine, die ihnen wieder das Gefühl gibt, dass das System für sie arbeitet. Weil dieses Bedürfnis politisch nicht aufgefangen wird, besetzen rechte Parteien das Feld. Sie bieten einen Systemwechsel an: Einen Systemwechsel weg von demokratischer Teilhabe hin zu autoritärer Kontrolle.
Dass es anders geht, zeigt das Beispiel des neuen Bürgermeisters Zohran Mamdani in New York. Mamdani durchbricht Knappheitsdenken, indem er ganz einfach sagt: Wir müssen nicht teilen, was kleiner wird. Wir lassen wachsen, was allen gehört. Er zeigt, dass öffentliche Investitionen, Mietendeckel, bessere Infrastruktur und klare Ansagen gegen Immobilienlobbys nicht spalten, sondern verbinden. Seine Kampagne zeigt, dass Menschen sehr wohl bereit sind, ein mutiges, progressives Projekt zu unterstützen, wenn man ihnen erklärt, wie man den Kuchen vergrößert. Er zeigt: Das Gegenteil von Nullsummenlogik ist kollektiver Zugewinn.
Ein System muss funktionieren, damit es verteidigt wird
Damit sind wir wieder bei Österreich. Wenn wir verhindern wollen, dass die Demokratie von innen erodiert, reicht es nicht, sie abstrakt zu verteidigen. Man kann Menschen nicht auffordern, ein System zu schützen, von dem sie glauben, dass es sie nicht schützt. Also, man kann schon, es wird nur nichts bringen. Jede Demokratie braucht ein ökonomisches Fundament. Sie braucht soziale Sicherheit. Sie braucht verlässliche öffentliche Dienstleistungen. Sie braucht ein Gefühl von Fairness.
Deshalb spricht die Ökonomin Isabella Weber heute von antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Sie meint damit eine Wirtschaftspolitik, die Demokratie schützt, indem sie Unsicherheit abbaut. Preisstabilität bei Grundbedürfnissen. Leistbares Wohnen. Gute Löhne. Arbeitszeit, die ein Leben ermöglicht. Öffentliche Infrastruktur, die funktioniert. Und eine Steuerpolitik, die Wohlstand zirkulieren lässt und Konzentration verhindert.
Das ist kein radikaler Systemsturz. Es ist schlicht die Rückkehr zu wirtschaftspolitischer Vernunft. Denn eine Demokratie, die Menschen in dauerhafter Knappheit hält, verspielt ihr eigenes Fundament.